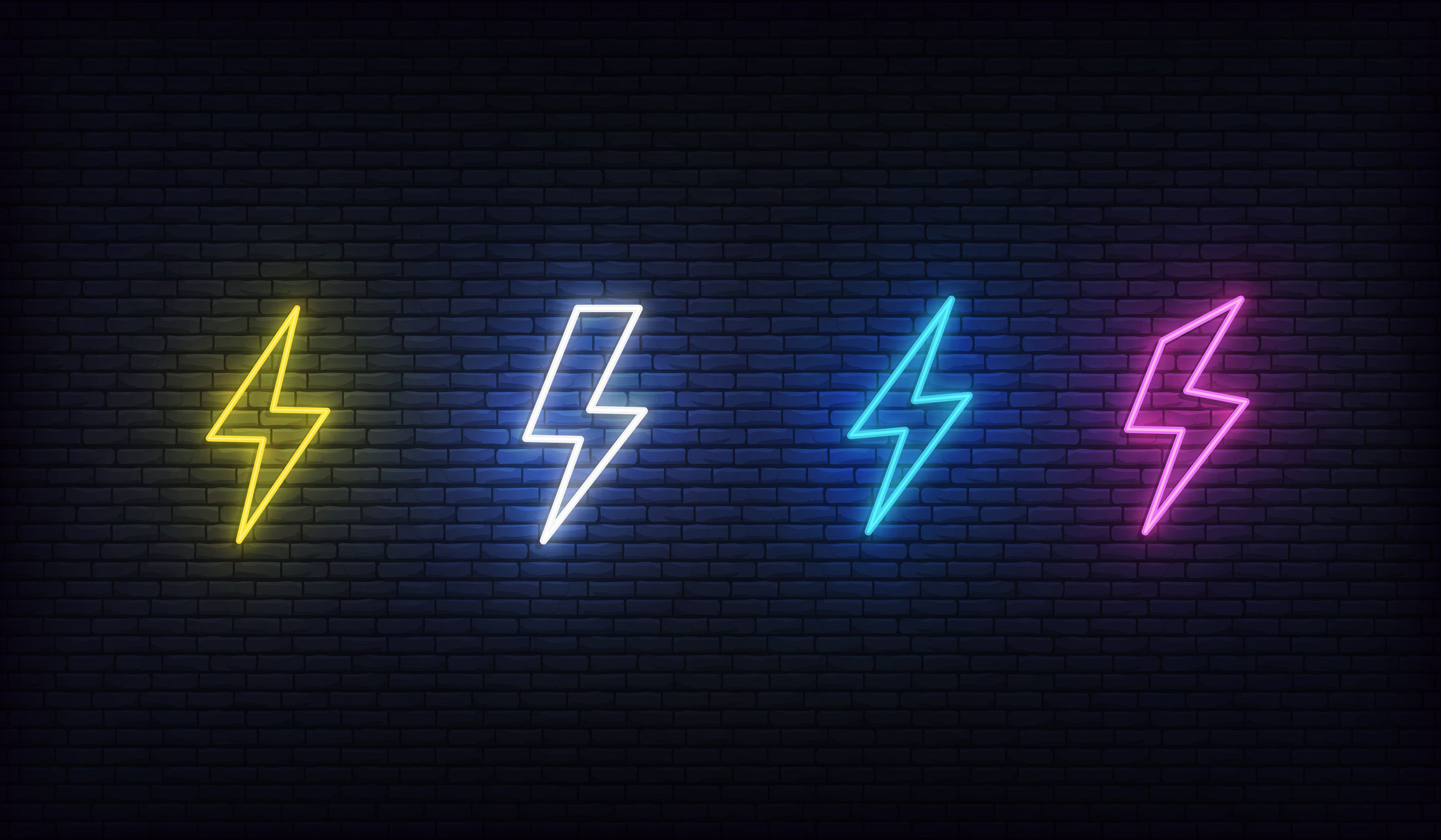Roboter sind längst nicht mehr nur Industriehelfer. Auch in der Pflege werden sie zur Entlastung des Personals getestet – wie bei der Stiftung Liebenau. Ein Modell mit Zukunft?
Schichtarbeit, viele Überstunden aufgrund von zu wenig Personal, fehlende Wertschätzung und körperlich sowie emotional zehrende Arbeit: Der Pflegeberuf ist nicht erst seit der Corona-Pandemie ein Knochenjob – den immer weniger Menschen ergreifen wollen.
Der Mangel an Pflegepersonal ist schon heute problematisch und könnte in Zukunft zu einer unserer größten Herausforderungen werden: Laut einer Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2018 wird die Lebenserwartung in den kommenden Jahrzehnten um bis zu fünf Jahre steigen. Allein 2030 wird es dadurch bereits 3,5 Millionen pflegebedürftige Menschen geben – 35 Prozent mehr als noch 2013, Tendenz weiter steigend.
Immer mehr pflegebedürftige Menschen also, aber immer weniger Personal. Eine mögliche Antwort auf das Problem: Assistenzroboter, die gewisse Teilaufgaben in der Pflege übernehmen können. Was nach Science-Fiction-Szenario klingt, könnte in Zukunft zum Alltag werden. Einige Pflegeeinrichtungen in Deutschland testen die Roboter bereits – und feiern kleine Erfolge. In welchen Aufgabenbereichen unterstützen die Roboter das Pflegepersonal bislang und was sollten sie in Zukunft können, um Pflegende optimal zu entlasten?
Kommunizieren, transportieren, spielen: Was Assistenzroboter können
Die Hochschule Ravensburg-Weingarten testet in Kooperation mit der Stiftung Liebenau den Roboter Pepper in der Altenpflege. Benjamin Stähle, stellvertretender Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, erklärt, dass eher von Assistenz- als von Pflegerobotern gesprochen werden sollte. Denn sie könnten bislang zwar einfache Kleinstaufgaben übernehmen und dadurch Pflegekräfte teilweise entlasten – aber diese nie vollständig ersetzen.
Laut Stähle können die Roboter bislang in einzelnen Teilbereichen eingesetzt werden, zum Beispiel als reine Transportsysteme, die Waren von A nach B bringen. Oder als soziale Interaktionsroboter – wie Pepper, der sportliche Übungen vormachen, Antworten geben und mit Menschen spielen kann. Richtige Assistenzroboter, die über fortgeschrittene Sensorik und einen Roboterarm verfügen, gibt es dagegen momentan eher selten, da sie sehr teuer sind und noch besser ausgearbeitet werden müssen.
„Alles, was über Navigationsaufgaben und grundlegende Interaktion – zum Beispiel Frage-Antwort-Konversationen – hinausgeht, ist aktuell noch Gegenstand aktiver Forschung“, sagt Stähle. Dazu zählten zum Beispiel die zuverlässige Erkennung der Umgebung oder die Emotionserkennung in der Mensch-Roboter-Interaktion.
In der Pflegeeinrichtung der Stiftung Liebenau in Ehningen macht Pepper vor, was bald zum Alltag jeder Einrichtung gehören könnte: Er grüßt, motiviert, lobt, macht Übungen vor und führt einfache Konversationen. Das kommt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern gut an. „Durch seine großen Augen und seine freundliche Ausstrahlung hegen viele Bewohnerinnen und Bewohner hohe Sympathiewerte für Pepper“, sagt Julian Krüger, Einrichtungsleitung in Ehningen.

Mein Assistent, der Roboter: Ein Blick in die Zukunft
Die Kooperation mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten ermöglicht, dass Pepper stetig weiterentwickelt wird. Die Assistenzroboter von Heute müssen schließlich noch eine Menge lernen, um in der Pflege von Morgen eine echte Hilfe sein zu können. In welchen Bereichen das besonders notwendig wäre, weiß Krüger: „Tatkräftige Unterstützung durch Roboter wäre wünschenswert in der pflegerischen Versorgung, zum Beispiel beim Waschen oder für die Mobilisierung in den Rollstuhl. Aber auch als Erinnerungs- und Orientierungshilfe: zum Beispiel durch regelmäßiges Erinnern an den Toilettengang oder als Unterstützung bei der Orientierung im Raum.“ Außerdem sei ein Roboter als Begleitung für Menschen mit hohem Laufdrang eine gute Unterstützung oder – wie Pepper – für Gespräche. Insbesondere bei kognitiv eingeschränkten Personen.
Eine ideale Arbeitsteilung von Roboter und Pflegeperson könnte laut Krüger zukünftig so aussehen: Der Roboter unterstützt datenbasiert individuell bei der Erkennung von Risiken – und gibt Vorschläge für Maßnahmen an die Pflegefachkraft. „Diese entscheidet dann jedoch selbst, welche Maßnahmen tatsächlich durchgeführt werden sollen“, so Krüger. Gerade bei Serviceaufgaben wären die Roboter auch eine willkommene Hilfe: bei der Zimmerreinigung oder der Wäsche- und Essensverteilung. Dadurch könnte das Personal wieder mehr Zeit für soziale Interaktionen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern bekommen.
„Grundsätzlich müssen die Geräte in Summe weiterentwickelt und langfristig deutlich günstiger werden“, sagt Stähle. „Hier zeichnet sich schon seit Jahren eine Tendenz ab, aber bisher gibt es noch kein System, welches alle Erwartungen erfüllen kann.“ Durch Kooperationen wie die der Stiftung Liebenau mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten ist eine passende Weiterentwicklung der Roboter für die Pflege allerdings leichter. Sie können ein erster Schritt auf dem Weg in eine digitalisierte Zukunft der Pflege sein.

Die Zukunft der Pflege: Mensch und Roboter Hand in Hand
In der Industrie sind Roboter schon lange ein fester Bestandteil, und auch im Bereich der Pflege sehen wir eine stetige Entwicklung von Assistenzrobotern, die das Pflegepersonal bei verschiedenen Aufgaben unterstützen können. Die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine bietet dabei eine vielversprechende Lösung für die wachsende Anzahl pflegebedürftiger Menschen und den Mangel an Pflegepersonal.
Die Automatisierung bestimmter Aufgaben durch Roboter kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise könnten Roboter als Transportmaschinen für Waren und Medikamente eingesetzt werden. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und fortgeschrittener Sensorik könnten Roboter auch in der Lage sein, menschliche Emotionen besser zu erkennen und darauf einzugehen. Unternehmen, die sich mit der Entwicklung solcher Roboter beschäftigen, arbeiten bereits daran, diese Fähigkeiten weiter auszubauen.
Ein wichtiger Aspekt ist auch die Entlastung des Pflegepersonals von Routineaufgaben, sodass mehr Zeit für soziale Interaktionen und persönliche Zuwendung bleibt. Hierbei könnten Roboter beispielsweise bei der Zimmerreinigung, Wäsche- und Essensverteilung eingesetzt werden. Damit die Maschinen in der Pflegebranche effektiv eingesetzt werden können, müssen sie jedoch noch weiterentwickelt und kostengünstiger werden.
Die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter sollte dabei stets auf einer partnerschaftlichen Ebene erfolgen. Die Entscheidungsgewalt sollte weiterhin beim Menschen liegen, der sich auf die Fähigkeiten der Roboter verlassen kann, um bessere Entscheidungen zu treffen. Die Kombination von menschlicher Erfahrung und künstlicher Intelligenz kann dabei helfen, die Qualität der Pflege zu erhöhen und den Arbeitsalltag der Pflegekräfte zu erleichtern.
Eine digitalisierte Zukunft der Pflege ist kein fernes Bild mehr. Durch Kooperationen wie die der Stiftung Liebenau mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten wird die Entwicklung von Assistenzrobotern für den Pflegebereich vorangetrieben. Es ist wichtig, dass diese Entwicklungen im Einklang mit ethischen und sozialen Fragestellungen vorangetrieben werden, um eine Zukunft zu schaffen, in der Mensch und Maschine Hand in Hand arbeiten, um die Herausforderungen einer alternden Welt zu bewältigen.
Das könnte Sie auch interessieren: Berufskleidung für Pflegeberufe: Darauf kommt es an.